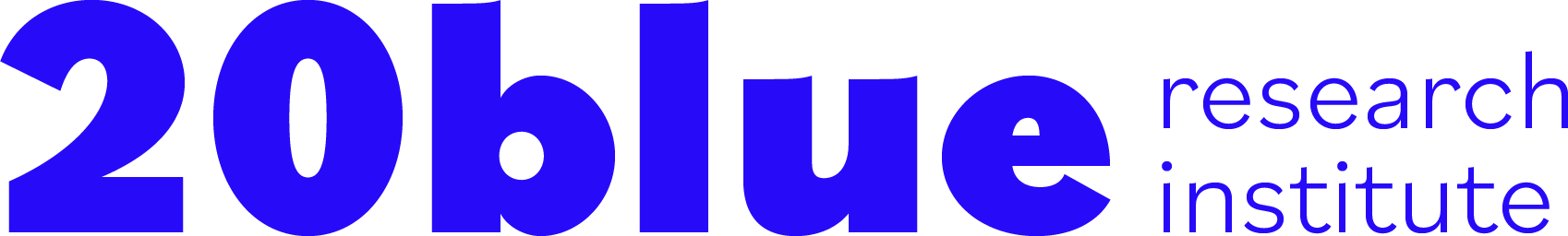Warum ist Interdisziplinarität heute wichtig? 2 Beispiele & 8 Tipps

Früher ein Zeichen der Geringschätzung, wäre ein „Ministerium für Querschnittaufgaben“ im Jahr 2021 eher Zeuge von Fortschrittsdenken. Denn zur Lösung der komplexen Krisen unserer Zeit braucht es verschiedene Disziplinen, die sich zusammentun: Das ist Interdisziplinarität.
Was glauben Sie: Welches Ministerium wird wohl nach der Bundestagswahl neu gebildet? Das Klimaministerium? Das Digitalisierungsministerium? Ein Ministerium für Chancengleichheit? Ministerien nach Wahlen neu zuzuschneiden oder neu zu gründen, ist Usus. Besonders häufig davon betroffen: Umwelt und Soziales. Die beiden Bereiche, die am ehesten zum Ausdruck von komplexen Krisen werden.
Die Wirklichkeit hat viele Perspektiven – und komplexe Krisen sind real. Deren Lösung braucht die Fähigkeit der verschiedenen Parteien, aufeinander ein- und zuzugehen. Besondere auf politischer Ebene ist es nötig, dass Interdisziplinarität nicht die Ausnahme ist, sondern zur Norm wird.
Interdisziplinarität definiere ich im weitestmöglichen Sinne. Weil ich es, wissenschaftsübergreifend, vor allem auf die Praxis beziehe: Auf alle Stakeholder, die eine Stimme in der Debatte brauchen und die es sich zu hören lohnt. Das ist die Interdisziplinarität des 21. Jahrhunderts.
Wie weit wir sind in Sachen Interdisziplinarität? Ich würde sagen, wir üben noch. Deutschland ist jetzt nicht so wirklich die Wiege des offenen Diskurses. Ich habe den Eindruck, dass wir zwar viel streiten, es aber eigentlich hassen, uns tatsächlich mit komplexen Krisen auseinanderzusetzen. Interdisziplinarität im öffentlichen Diskurs klingt in Deutschland eher nach einer Kakophonie, nach einem (sehr) schräg singender Chor.
2 Beispiele, die Ihnen bekannt vorkommen
Bei diesen beiden wichtigen Themen sind mehr Perspektiven sehr wichtig:
Beispiel Digitalisierung: Nur ein technisches Problem?
In zwanzig Jahren Digitalisierungspolitik haben wir Deutschen eines gelernt: Es gibt kein vordergründig technisches Problem. Sonst wäre es längst gelöst. Die Frage, wie aus von Menschen miteinander verhandelten – manche sagen willkürlichen – Prozessen einsehbare und transparente werden, ist sehr komplex.
Denken Sie an die Abschaffung des Bargelds – technisch überhaupt kein Problem. Aber als Schlupfloch für kleine und große kriminelle Akte oder als emotionaler Träger muss es offenbar bleiben. Würde es durch digitale Zahlungswege ersetzt, müssten noch alle Einkaufswägen und Bahn-Schließfächer ausgetauscht werden, von der Abrechnung in Berliner Kneipen ganz zu schweigen.
Es fällt schwer, ernsthaft über die Digitalisierungsprobleme in Deutschland zu schreiben, weil die Hinderungsgründe eine üble Mischung aus Nicht-Können und Nicht-Wollen sind. Alle Versuche, das ganze interdisziplinär anzugehen – also technologische, soziale, wirtschaftliche und politische Ebenen so zu verbinden, dass das Ergebnis eine einheitliche Strategie ist – haben lediglich dazu geführt, dass wir drittletzter Digitalisierungsmeister in Europa sind. Aber sicher bald Weltmeister im Datenschutz. Gäbe es eine interdisziplinäre Runde, die ohne Machtspiele auskäme, würden wir eine Delegation nach Dänemark schicken, uns die Smart Cities Amsterdam und Barcelona zum Vorbild nehmen und mal bei den Esten anfragen, ob sie uns eine digitale Roadmap erstellen möchten. Alles europäische Beispiele mit ordentlichem Datenschutz. Aber eben auch schnellem Internet, digitaler Gesundheitsversorgung und der Möglichkeit, offizielle Dokumente online zu beantragen.
Beispiel Nachhaltigkeit: Alte Industrienation vs. grüne Wirtschaft
Die Wirklichkeit weist in zwei Richtungen: Zu den alten Industrienationen, die einen Großteil des Bruttosozialprodukts und der Arbeitsplätze stellen – und auf den Werten der Wachstumsökonomie ruhen, und sich nun neu erfinden muss. Andererseits zur neuen grünen Wirtschaft, in der viele kleine und wenige große Player das Versprechen verwirklichen wollen, dass nachhaltiges, zirkuläres Wirtschaften möglich ist.
Nachhaltigkeit war deshalb lange ein Nischenthema, weil seine Umsetzung in der klassischen Wachstumsökonomie widersprüchlich zu ihren Zielen steht: Sollen möglichst viele Menschen am Wohlstand teilhaben, der Wohlstand selbst aber unbegrenzt definiert bleibt, gibt es keine Nachhaltigkeitsstrategie. Deshalb gilt Nachhaltigkeit bis heute, in immer leiser murmelnden konservativen Kreisen, noch als versponnene Idee der Grünen.
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zum Thema Nachhaltigkeit müsste weit über die Grenzen der Umweltpolitik hinaus grundlegende Fragen zu den ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen. Sie müsste eine Antwort auf die Frage finden, wer zu welchem Nachhaltigkeitsbeitrag verpflichtet werden kann und muss. Die Nachhaltigkeitsdebatte ist die interdisziplinäre Feuertaufe, weil sie mit einem Augenblinzeln in populistische Positionen abgleitet. Und darauf angewiesen ist, dass es ein gemeinsames Verständnis von Methoden und Erkenntnissen gibt. Gelänge dies, stünde am Ende möglicherweise ein zukunftsweisender Vertrag, in dem sich Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft auf ein neues Grundverständnis eines guten Lebens einigen. Sicher wäre auch einiger Wildwuchs eingehegt, etwa aus der Finanzwirtschaft. Oder es bliebe die Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit Augenwischerei ist.
8 Tipps
Soweit die Theorie. Hier kommt das praktische Problem: Nicht die Interdisziplinarität als solches, sondern deren Umsetzung gehört zu den großen, noch ungelösten Rätseln – meiner Beobachtung nach scheitert es oft an einem Mangel an Neugier, an der Angst, Kompetenzen abgeben zu müssen oder falsch gelegen zu haben. Dabei ist das Wunderbare an Interdisziplinarität, dass es sich um eine –wird sie richtig angewendet – bereichernde Auseinandersetzung handelt. Dann kann man ungehemmt oft „Aha, das wusste ich noch nicht, interessant!” sagen. Oder „Kannst du das noch einmal genauer erläutern?”
Sie haben Lust, mit ihrem Team interdisziplinäres Arbeiten einmal auszuprobieren? Dann nichts, wie los. Diese 8 Tipps helfen Ihnen, Fehler zu vermeiden:
Zeigen Sie Verständnis: Interdisziplinäre Runden sind fragil, weil alle Teilnehmer ihre fachliche und sprachliche Komfortzone verlassen. Nutzen Expert*innen verschiedener Disziplinen ausschließlich ihre jeweilige Fachtermini, bleiben Diskussionen unklar. Man versteht sich nicht. Deshalb: Stellen Sie Verständnisfragen. Es gibt kein Richtig und kein Falsch in interdisziplinären Debatten – es gibt lediglich andere Aspekte.
Sorgen Sie für Profilierung: Es geht um Positionen, nicht um Personen. Sorgen Sie dafür, dass Eitelkeiten außen vor bleiben. Fragen Sie immer wieder, ob Sie hier sind, um etwas zu lernen oder um Recht zu behalten.
Legen Sie (keine) Hierarchien fest: Alle Gruppenmitglieder müssen sich zum Arbeitsthema fundiert äußern können. Treffen Sie eine gute Vorauswahl der Personen und stellen Sie eine möglichst hierarchiefreie Situation her, in der jede Position ihren Wert erhält. Alle Positionen sind gleichwertig.
Stellen Sie eine gute Moderation sicher: Um interdisziplinäre Runden konfliktfrei zu halten, braucht es eine gute Moderation, die von allen als Autorität akzeptiert wird. Sie unterbindet sublime Machtdemonstrationen oder Manipulationen.
Definieren Sie Leads: Sie sind für größeren Runden nötig – und für „bühnenscheue“ Expert:inenn. Der Lead ist in der Lage, die gemeinsame Haltung sprachlich gut zusammenzufassen und der Gruppe zu präsentieren. Er bietet einen Schutzraum zum fachlichen Austausch.
Nutzen Sie die Raketenmethode: Wenn es schnell gehen muss: In einer festgesetzten Reihenfolge erfasst jede:r Einzelne die Fragestellung. Er oder sie diskutiert diese zuerst mit Person 1, beide danach mit Person 2, diese drei dann mit anderen 4 Mitgliedern. Im Ergebnis kommen alle gemeinsam zu einem Konsens. Spannend und – sehr zufriedenstellend.
Wählen Sie Ihre Sprache klug und klar: Jede Position muss immer auch für Fachfremde nachvollziehbar erklärt werden können – und anschlussfähig für die Debatte sein. Sprache ist Distinktion. In interdisziplinären Runden gilt genau das Gegenteil: Je klarer ich formuliere, desto mehr Wirkung entfaltet meine Position.
Nix geht mehr? Nutzen Sie den ultimative Konfliktlösungssatz: “We agree to disagree”. Dieser Satz manövriert Sie aus jeder hoffnungslosen Lage heraus. Diese Pattsituation zeigt aber auch: Die Sache ist komplizierter als gedacht. Und das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass eine andere Methode gewählt werden muss. Auch das kann eine Lösung sein.
Fazit:
Interdisziplinäres Arbeiten ist die Methode der Wahl, um für komplexe Probleme Lösungsansätze zu entwickeln. Sie ermöglicht umfassende Resultate, bietet weitreichende, oft überraschende, Erkenntnisse und unterstützt die Teambildung.
Wir bilden interdisziplinäre Expert Hubs für Changeprojekte. Gerne diskutieren wir Ihren Bedarf mit Ihnen.
Expert Insight nachhaltige Lieferkette
Was ist eine nachhaltige Lieferkette und welche Auswirkungen hat das LkSG? Wie kann aktives Lieferantenmanagement im Sinne des LkSG aussehen und wie profitieren Zulieferer davon? Diese und weitere Fragen beantwortet der Expert Insight von Daria Mak-Walther. Sie erhalten 14 Seiten (PDF).
Jetzt bestellen!Weitere interessante Beiträge

Kooperation in kollaborativ: wie Business-Partnerschaften gelingen
Kooperation in kooperativ: Wie funktionieren gelungene Business-Partnerschaften im agilen Krisenzeitalter? Eine Bestandsaufnahme von Anja Mutschler, 20blue

20blue minutes #17: Prof. Dr. Ralf Wehrspohn
In der 17. Folge der 20blue minutes ist Prof. Ralf Wehrspohn von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu Gast, um mit Anja Mutschler über disruptive und inkrementelle Innovationen im Zusammenspiel von Forschung...

20blue minutes #16: Daniel Probst
In der sechzehnten Folge der 20blue minutes spricht Anja Mutschler mit Daniel Probst von Verwegener & Trefflich darüber, was die Idee von der Innovation unterscheidet und wie sich Menschen und...

My persons of interest
Person of Interest: welche Art von Kunde passt eigentlich zu 20blue? Anja Mutschler skizziert ihren optimalen Kunden für wissenschaftliche Beratung und erklärt, mit wem wir lieber nicht zusammenarbeiten.
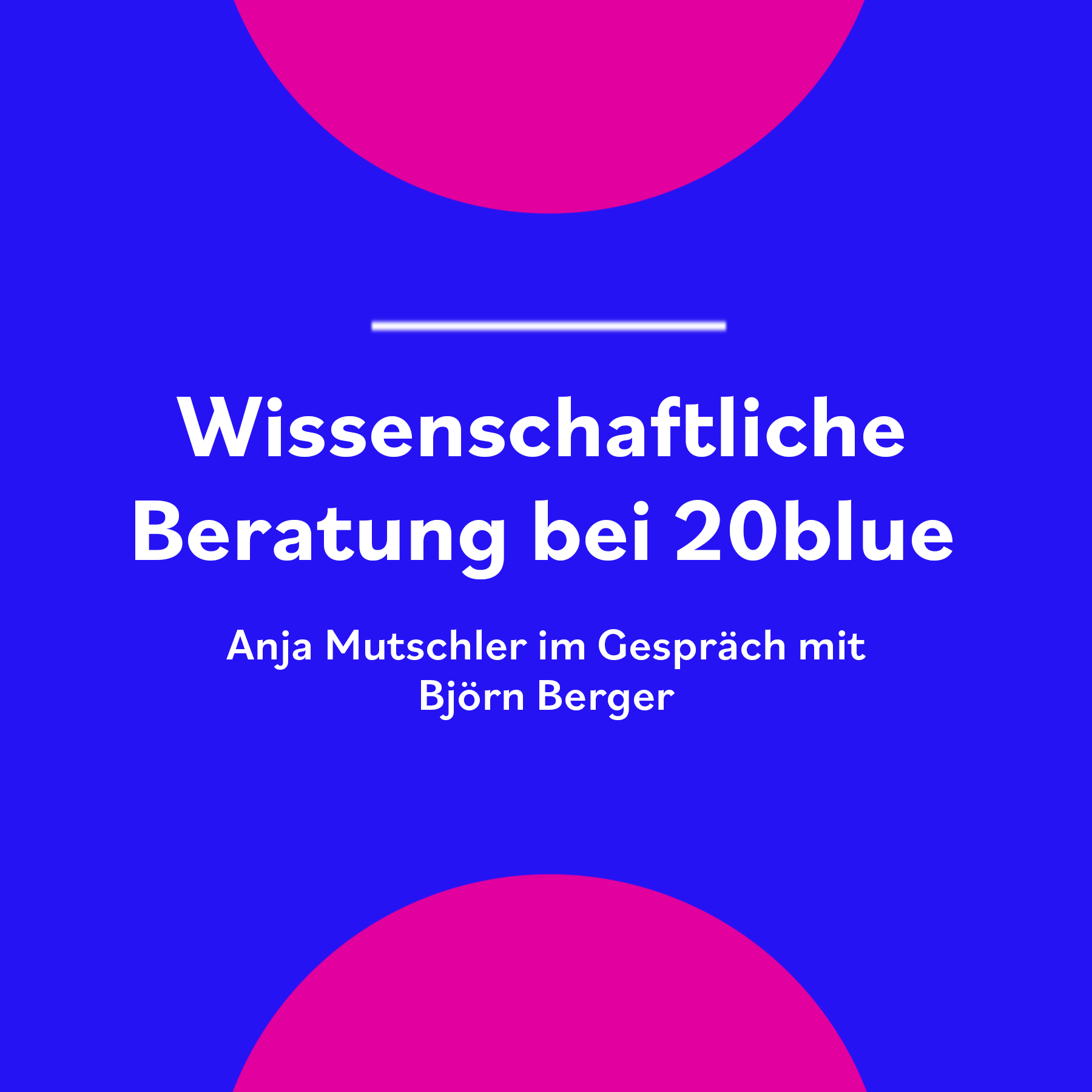
20blue hour, Folge 14: wissenschaftliche Beratung bei 20blue
Wie funktioniert das eigentlich genau, wenn 20blue ein Projekt bearbeitet? In der 14. Folge der 20blue hour sprechen Anja Mutschler und Björn Berger über Wissenschaft, Methoden und die besten –...

Von Cross-Culture Consultancy zum Global Claim Check
Claims oder Logos international machen: der Global Claim Check von 20blue hilft weiter. Was steckt inhaltlich und methodisch hinter einer unserer häufigsten Internationalisierungs-Leistungen?
Über 20blue
Das Research Institute 20blue bringt Sie weiter! Wir sorgen seit 2011 mit wissenschaftlichen Insights und Methoden für den nötigen Durchblick. Unser Research Institute sichert Entscheidungen ab - dank 300 Expert*innen aus vielen Disziplinen, Branchen und Ländern. Ebenso vielfältig: unsere Kunden aus Wirtschaft und Politik. Im interdisziplinären Zusammenspiel entsteht neues Wissen auf dem Weg zur nachhaltigen Transformation.
Mehr erfahrenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen